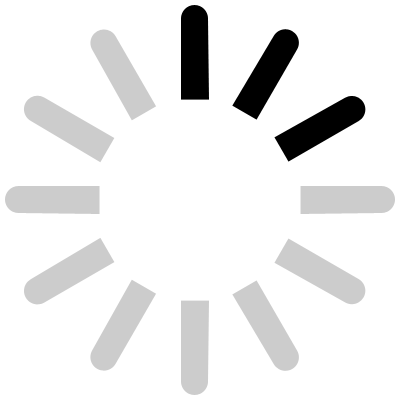03044 Gesetzliche Anforderungen an die Abwärmenutzung nachhaltig und gewinnbringend umsetzen
|
Dieser Artikel möchte praktische Hilfestellung bei der Identifizierung von Abwärmepotenzialen und der Bewertung der relevanten Informationen geben. Er soll dazu dienen, trotz des Aufwands den größtmöglichen Nutzen aus den Verpflichtungen zu ziehen.
Neben den gesetzlichen Anforderungen sowie allgemeinen Herausforderungen und Hinweisen zur Ermittlung von geführten und diffusen Abwärmepotenzialen wird die Vorgehensweise zur Ermittlung verschiedener Abwärmepotenziale detailliert erläutert.
Anhand der Lösungen der Firma APESS wird gezeigt, wie Abwärmenutzung wirtschaftlich umgesetzt werden kann: Ein Beispiel, bei dem eine ganze Fabrik inklusive Bürogebäude ohne fossile Brennstoffe oder Fernwärme auskommt und darüber hinaus 40 % Energie gegenüber dem heutigen Stand der Technik einspart. von: |
1.1 Abwärmevermeidung, -nutzung und Meldung gemäß EnEfG
Ziel der gesetzlichen Verpflichtung zur Vermeidung, Nutzung und Meldung von Abwärme ist es – neben der Bekämpfung des Klimawandels und der Reduzierung von Verlusten und damit verbundenen Kosten –, eine Schnittstelle zwischen Anbietern von Abwärme und potenziellen Abnehmern zu schaffen.
Das „Matchmaking” kann als Chance gesehen werden und die Transparenz der Energieströme im Unternehmen erhöhen, auch wenn der Aufwand des Unternehmens und der beteiligten Beschäftigten Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Da kein wirtschaftliches Unternehmen etwas zu verschenken hat, kann es sich für das Unternehmen dennoch bezahlt machen, sich mit dem Thema zu befassen. Nachfolgend werden die relevantesten Passagen des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) zum Kontext Abwärme kurz vorgestellt.
Gemäß § 8 Abs. 3 hat ein Unternehmen, das ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einzurichten hat, mindestens folgende zusätzliche Anforderungen als Teil des Energie- oder Umweltmanagementsystems zu erfüllen:
| • | Erfassung von Daten von Abwärmequellen, wie die Zufuhr und Abgabe von Energie, Prozesstemperaturen, abwärmeführenden Medien mit ihren Temperaturen und Wärmemengen, möglichen Inhaltsstoffen sowie von technisch vermeidbarer und technisch nicht vermeidbarer Abwärme, |
| • | Identifizierung, Darstellung und Bewertung von technisch realisierbaren Maßnahmen zur Abwärmerückgewinnung und -nutzung, |
| • | Wirtschaftlichkeitsbewertung der identifizierten Maßnahmen nach der VALERI-Methode gemäß DIN EN 17463. |
Gemäß § 16 sind weitere Unternehmen, die einen jährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre von mindestens 2,5 Gigawattstunden haben (Novellierung auf 2,77 geplant), verpflichtet
| • | entstehende Abwärme nach dem Stand der Technik zu vermeiden, |
| • | anfallende Abwärme auf den Anteil der technisch unvermeidbaren Abwärme zu reduzieren, soweit dies möglich und zumutbar ist, |
| • | die anfallende Abwärme durch Maßnahmen und Techniken zur Energieeinsparung durch Abwärmenutzung wiederzuverwenden, soweit dies möglich und zumutbar ist. Hierbei sind technische, wirtschaftliche und betriebliche Belange zu berücksichtigen. |
Gemäß § 17 Plattform für Abwärme sind diese Unternehmen auch verpflichtet
| • | auf Anfrage von Betreibern von Wärmenetzen oder Fernwärmeversorgungsunternehmen und sonstigen potenziellen wärmeabnehmenden Unternehmen Auskunft zu geben über relevante Informationen bezüglich anfallender unmittelbarer Abwärme, |
| • | Informationen in die Plattform für Abwärme elektronisch einzureichen und die Einträge bis zum 31. März eines jeden Jahres zu aktualisieren. Die Frist zur erstmaligen Meldung endet am 01.01.2025. |
Dieser Artikel hilft Ihnen mit möglichst geringem Aufwand die Informationen bis zum Ende des Jahres 2024 zu beschaffen bzw. plausible Abschätzungen vorzunehmen.
Die Plattform für Abwärme kann seit dem 04.11.2024 genutzt werden.
Androhung von Bußgeldern
| • | Wer vorsätzlich oder fahrlässig Abwärme nicht vermeidet oder nicht reduziert, handelt ordnungswidrig. Dies kann mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 € geahndet werden (s. § 19 Abs. 1 Punkt 7 und Abs. 2). |
| • | Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine relevante Auskunft Betreibern von Wärmenetzen oder Fernwärmeversorgungsunternehmen und sonstigen potenziellen wärmeabnehmenden Unternehmen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt oder eine Information zur Meldung in der Plattform für Abwärme nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig aktualisiert, handelt ordnungswidrig. Dies kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € geahndet werden (s. § 19 Abs. 1 Punkt 8 und Abs. 2). |
Die Abbildung 1 aus dem BfEE-Webinar im Oktober 2024 zeigt, wie man die Meldepflicht prüfen kann:
Abb. 1: Prozessdarstellung zur Ermittlung der Meldepflicht [1]
Im Webinar wurde darauf hingewiesen, dass
| • | für die Ermittlung der Abwärmemenge Schätzungen und Modellierungen von Werten zur Abwärme grundsätzlich erlaubt sind (Kap. 5 im Merkblatt für die Plattform für Abwärme Version 1.3). Diese müssen plausibel und nachvollziehbar sein. |
| • | der Messpunkt grundsätzlich der Abgabeort der Abwärme an die Umwelt ist; wenn sinnvoll ist er auch weiter vorne im Prozess möglich (Kap. 6.2 im Merkblatt für die Plattform für Abwärme V. 1.3) |
| • | weitere Kriterien erforderlich sind wie Betriebsstunden und Temperaturen |
| • | Abwärme aus einer Anlage ab 1.500 Betriebsstunden im Jahr betrachtet werden muss und wenn diese eine Abwärmetemperatur ab 25 °C im Jahresdurchschnitt hat (Zeitraum: letztes vollständiges Kalenderjahr oder letzte 12 Monate) sowie ein Abwärmepotenzial ab 200 MWh/a |
| • | pro Standort ab 800 MWh/a eine Meldepflicht besteht |
| • | die geplante Novelle des EDL-G die Anforderungen an ein Energieaudit gemäß § 8a Abs. 1 Nr. 4 um die Erfassung von Abwärmedaten erweitert. |
Weitere Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen des EnEfG finden Sie im Beitrag „Anforderungen an Abwärme und Endenergie im EnEfG – Wie können diese normkonform in die ISO 50001 integriert werden?” (s. Kap. 03041).
Das überarbeitete Merkblatt für die Plattform für Abwärme finden Sie auf der Webseite der Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE).
1.2 Alternative zur Erfüllung von 65 % erneuerbaren Energien über Abwärmenutzung im GEG
Auch Nicht-Wohngebäude müssen die Vorgabe des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) einen Erneuerbare-Energien-Anteil an der Wärmeversorgung von 65 % erfüllen. Gerade kleinere Unternehmen können durch die Nutzung von Abwärme, z. B. über eine Wärmerückgewinnung in Verbindung mit einer Abwärme-Wärmepumpe unter die Grenze des durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauchs von 2,5 GWh/a kommen (bzw. nach der Novellierung von 2,77 GWh/a). Hierdurch bräuchten sie deutlich weniger Verpflichtungen zu erfüllen und könnten Kosten sparen sowie ihre Energieautarkie und Nachhaltigkeit deutlich steigern.
Alternativ zu den 65 % erneuerbaren Energien darf auch gemäß § 71 Abs. 1 unvermeidbare Abwärme verwendet werden, um das GEG einzuhalten.
Unternehmen können die Anforderungen erfüllen, wenn die Abwärme über ein technisches System nutzbar gemacht und im Gebäude zur Deckung des Wärmebedarfs eingesetzt wird. Auch die zu installierende Wärmeleistung in einer neuen oder modernisierten Energiezentrale sinkt beträchtlich, wenn Abwärmepotenziale konsequent ausgeschöpft werden. Zugleich kann der Anteil notwendiger erneuerbarer Energien und der damit verbundenen Kosten um schätzungsweise 40 bis 60 % gesenkt werden.
Durch eine gezielte Abwärmenutzung in Verbindung mit einer Wärmepumpe können u. a. die GEG-Anforderungen in § 71 h mit einem aktuellen Brennwertkessel erfüllt werden, wenn der Anteil bei bivalent parallelem oder bivalent teilparallelem Betrieb mindestens 30 % bzw. mindestens 40 % bei bivalent alternativem Betrieb, erreicht wird, – bei gleichzeitiger Ersparnis an Investitions- und Energiekosten.