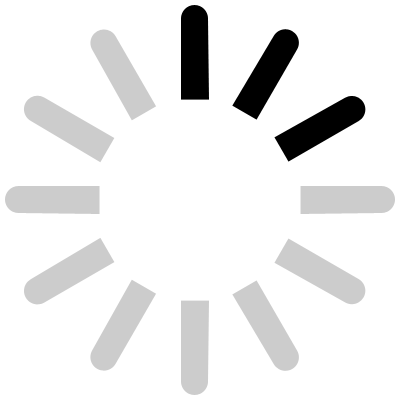1 Erleichterungen des EnEfG und Änderungen des EDL-G vertagt und in die Ausschüsse verwiesen
Die Planung war perfekt, um die Erleichterungen des EnEfG noch vor der Sommerpause in Kraft treten zu lassen. Doch der Bundestag entschied am 03.07.2024, den Vorgang in die Ausschüsse zu verweisen. Voraussichtlich im Oktober werden die Gesetzesänderungen erneut beraten.
Geplante Änderungen
Die wesentlichen geplanten Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Die wesentlichen geplanten Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
| • | Die Pflicht zur Durchführung eines Energieaudits ist künftig nicht mehr von der Unternehmensgröße, sondern nur noch vom Endenergieverbrauch des Unternehmens abhängig. Der Schwellenwert liegt dann bei 2,77 GWh/a (1:1 Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie), d. h. Unternehmen müssen nun ab 2,77 GWh/a ein Energieaudit durchführen (bisher 0,5 GWh/a für Großunternehmen). Ab 7,5 GWh/a müssen sie ein EnMS nach ISO 50001 bzw. EMAS einführen (für öffentliche Stellen und Rechenzentren gelten andere Werte). |
| • | Die Pflicht, Umsetzungspläne zu veröffentlichen, soll von 2,5 GWh/a auf 2,77 GWh/a angehoben werden. Die bisher vorgesehene Pflicht, die Pläne vor Veröffentlichung durch eine Zertifizierungsstelle prüfen zu lassen, soll ersatzlos gestrichen werden. Die Pläne müssen jährlich aktualisiert werden. |
| • | Auch der Schwellenwert für die Meldepflicht an die Plattform für Abwärme (PfA) wird auf 2,77 GWh/a angehoben. Mittlerweile geklärt ist die Bagatellschwelle. Sie beträgt pro geführtes Abwärmepotenzial 200 MWh/a und pro Standort 800 MWh/a (Details s. das neue Merkblatt V. 1.3 vom 09.08.2024) |
| • | Die mit dem EnEfG eingeführten zusätzlichen Anforderungen an Abwärmeuntersuchungen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für technisch machbare Maßnahmen nach der VALERI-Norm DIN EN 17463 gelten zukünftig auch für Energieaudits nach dem EDL-G. |
| • | Energieauditoren müssen sich in Zukunft Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unterziehen. |
Das BAFA hatte zur Weiterbildung seiner Energieauditoren im Juni ein Webinar zu den Neuerungen veranstaltet, das sie 4-mal durchführte und damit über 1000 Energieauditoren erreichte. Die Folien und die Antworten zu im Webinar gestellten Fragen können auf der BAFA-Seite (s. u.) eingesehen werden.
Für den Autor gibt es aktuell immer noch eine Frage, die nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnte und die auch im Gesetzentwurf nicht gelöst wird.
Frage
Sind Unternehmen, die ein EnMS neu einführen müssen und dafür 20 Monate Zeit haben, auch verpflichtet, zum 01.01.2025 Einträge in die PfA zu machen?
Sind Unternehmen, die ein EnMS neu einführen müssen und dafür 20 Monate Zeit haben, auch verpflichtet, zum 01.01.2025 Einträge in die PfA zu machen?
Laut § 17 EnEfG sind Unternehmen ab 2,5 GWh/a (zukünftig 2,77 GWh/a) verpflichtet, Eintragungen in die Plattform für Abwärme zu tätigen (sofern die Bagatellgrenze überschritten wird).
In § 8 EnEfG ist das Thema „Abwärme” eindeutig an die Existenz eines EnMS/UMS nach EMAS gekoppelt, d. h. Unternehmen von 2,5 (in Zukunft 2,77) bis 7,5 GWh/a Gesamtendenergieverbrauch ohne EnMS/EMAS müssen intern noch keine Abwärme-Ermittlung etc. tätigen. Unternehmen ohne EnMS/EMAS haben 20 Monate Zeit, das System einzuführen. D. h., intern müssen diese Unternehmen das Thema Abwärme noch nicht bearbeiten, aber extern an die PfA müssen sie ggf. berichten.
Planwidrige Lücke
Auch die Begründung zu § 17 im EnEfG 2023 unterstreicht diese Verknüpfung zwischen System/Energieaudit und Abwärmeermittlung. Aber sowohl im aktuellen Gesetzestext als auch im neuen Gesetzesentwurf zu § 17 wird diese planwidrige Lücke nicht geschlossen, sodass einige Unternehmen zwar noch kein EnMS benötigen, aber schon die deutlich schwierigere Aufgabe der Abwärmeerfassung leisten müssen.
Auch die Begründung zu § 17 im EnEfG 2023 unterstreicht diese Verknüpfung zwischen System/Energieaudit und Abwärmeermittlung. Aber sowohl im aktuellen Gesetzestext als auch im neuen Gesetzesentwurf zu § 17 wird diese planwidrige Lücke nicht geschlossen, sodass einige Unternehmen zwar noch kein EnMS benötigen, aber schon die deutlich schwierigere Aufgabe der Abwärmeerfassung leisten müssen.
Die gleiche Frage wird sich mit der Änderung des EDL-G auch für KMU mit einem jährlichen Gesamtendenergieverbrauch von 2,77 GWh–7,5 GWh stellen. Auch für sie wird bei den Energieaudits eine Umsetzungsfrist von 20 Monaten gelten. Genau genommen werden sie sogar schon heute von § 17 adressiert und zur Eintragung von Abwärmepotenzialen verpflichtet, obwohl sie aktuell kein Energieaudit durchführen müssen, und die Zusatzanforderungen zur Abwärmeermittlung etc. auch erst mit der Gesetzesnovelle in Kraft treten werden.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Lücke auf der Zielgeraden noch erkannt und geschlossen wird.
Weitere Informationen
BAFA: Unterlagen zu den Webinaren vom Juni 2024 mit FAQ (unter „Informationen zum Thema”)
BAFA: Unterlagen zu den Webinaren vom Juni 2024 mit FAQ (unter „Informationen zum Thema”)
Bundestag: Regierung will Energieaudit-Pflicht erweitern (Juli 2024 mit Link zum Gesetzesentwurf)
2 Stompreiskompensation (SPK) und BEHG Carbon-Leakage-Verordnung (BECV): Vorprogrammiertes Chaos und Lösung der DEHSt
Engpass an prüfungsbefugten Stellen
Es war zu erwarten gewesen. Wie schon in den letzten Kurznachrichten im Mai berichtet, mussten die ökologischen Gegenleistungen (öGL) erstmalig durch prüfungsbefugte Stellen im FMS (Formular-Management-System) der DEHSt (Deutsche Emissionshandelsstelle) bestätigt werden. Die Informationsveranstaltung dazu fand am 24.04.2024 statt, das Fristende für den Eingang des Antrags war der 01.07.2024 (Montag). Für die elektronische Kommunikation waren ein VPS-Postfach und eine elektronische Signaturkarte erforderlich. Da der Erwerb einer elektronischen Signaturkarte bis zu mehreren Wochen in Anspruch nehmen kann, kam es – wen wundert es – zu einem Engpass an prüfungsbefugten Stellen (s. beispielsweise die Stellungnahme der energieintensiven Industrien in Deutschland (EID) zum Mangel an prüfungsbefugten Stellen für ökologische Gegenleistungen). Bekanntlich geht es bei der Strompreiskompensation für die energieintensive Industrie um Beihilfen in sechs- bis siebenstelliger Höhe, die nun Gefahr liefen, nicht ausgezahlt zu werden, weil der Antrag nicht fristgerecht eingereicht werden konnte.
Es war zu erwarten gewesen. Wie schon in den letzten Kurznachrichten im Mai berichtet, mussten die ökologischen Gegenleistungen (öGL) erstmalig durch prüfungsbefugte Stellen im FMS (Formular-Management-System) der DEHSt (Deutsche Emissionshandelsstelle) bestätigt werden. Die Informationsveranstaltung dazu fand am 24.04.2024 statt, das Fristende für den Eingang des Antrags war der 01.07.2024 (Montag). Für die elektronische Kommunikation waren ein VPS-Postfach und eine elektronische Signaturkarte erforderlich. Da der Erwerb einer elektronischen Signaturkarte bis zu mehreren Wochen in Anspruch nehmen kann, kam es – wen wundert es – zu einem Engpass an prüfungsbefugten Stellen (s. beispielsweise die Stellungnahme der energieintensiven Industrien in Deutschland (EID) zum Mangel an prüfungsbefugten Stellen für ökologische Gegenleistungen). Bekanntlich geht es bei der Strompreiskompensation für die energieintensive Industrie um Beihilfen in sechs- bis siebenstelliger Höhe, die nun Gefahr liefen, nicht ausgezahlt zu werden, weil der Antrag nicht fristgerecht eingereicht werden konnte.
Ca. zwei Wochen vor Ablauf (am Freitag, den 14.6.) präsentierte die DEHSt die Lösung. Eine Fristverlängerung wird es zwar nicht geben, aber die fehlende Verfügbarkeit von prüfungsbefugten Stellen führe dazu, dass der Rechtsgedanke der „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand” herangezogen werden kann. Für den Fall, dass eine Bestätigung durch eine prüfungsbefugte Stelle nicht fristgemäß mit dem Antrag eingereicht werden könne, kann das Unternehmen im Rahmen der Anhörung oder auch bereits mit Einreichung des Antrags glaubhaft machen, dass es ohne Verschulden verhindert war, die Frist einzuhalten. Hierfür reicht die Darlegung der Gründe aus, warum innerhalb der Antragsfrist keine Zertifizierungsstelle gefunden werden konnte. Für die Gewährung einer Beihilfe in beiden Antragsverfahren (SPK und BECV) ist weiterhin Voraussetzung, dass die Erklärungen und Nachweise zu den ökologischen Gegenleistungen von einer prüfungsbefugten Stelle bestätigt werden. Die Bestätigung ist unverzüglich nachzureichen. Im Weiteren erläutert die DEHSt noch Erleichterungen für die Unternehmen und auch „workarounds” für die prüfungsbefugten Stellen ohne VPS-Postfach und qualifizierte Signatur.
Auch wenn es letztlich eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu geben scheint, so hätte dies durch zeitgemäße Kommunikation vermieden werden können.
Weitere Informationen
EID: Stellungnahme der energieintensiven Industrien in Deutschland (EID) zum Mangel an prüfungsbefugten Stellen für ökologische Gegenleistungen (06/2024)
EID: Stellungnahme der energieintensiven Industrien in Deutschland (EID) zum Mangel an prüfungsbefugten Stellen für ökologische Gegenleistungen (06/2024)
3 Herkunftsnachweisregister bald auch für Gas, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien
Die verpflichtende Stromkennzeichnung des Energieversorgers nach § 42 EnWG liefert den Endkunden wichtige Informationen zu ihrem Strom. Seit Januar 2023 darf ein Energieversorger Strom nur dann als solchen aus erneuerbaren Energien (EE) kennzeichnen und auf der Stromrechnung ausweisen, wenn er für die gelieferte Menge EE-Strom auch Herkunftsnachweise im Herkunftsnachweisregister entwertet hat. Damit wird die Stromkennzeichnung verlässlicher, und eine Doppelvermarktung soll ausgeschlossen werden.